Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /pages/wp-content/plugins/aesop-story-engine/public/includes/components/component-cbox.php on line 52
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /pages/wp-content/plugins/aesop-story-engine/public/includes/components/component-cbox.php on line 53
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /pages/wp-content/plugins/aesop-story-engine/public/includes/components/component-cbox.php on line 54
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /pages/wp-content/plugins/aesop-story-engine/public/includes/components/component-cbox.php on line 55
Warning: Undefined array key 1 in /pages/wp-content/plugins/aesop-story-engine/public/includes/components/component-cbox.php on line 53
Warning: Undefined array key 2 in /pages/wp-content/plugins/aesop-story-engine/public/includes/components/component-cbox.php on line 54
Warning: Undefined array key 3 in /pages/wp-content/plugins/aesop-story-engine/public/includes/components/component-cbox.php on line 55
Sieglinde Sperling zieht genussvoll an ihrer Zigarette. „Immer wenn die beiden hier sind, rauchen wir zusammen eine Zigarette. Alleine mache ich das nicht“, erzählt sie. „Na, ohne Hilfe bekommst du ja auch nicht das Feuerzeug an“, sagt Rolf Siegmeier. „Pass bloß auf, Du!“, droht Sperling. Ernst meint sie ihre Drohung nicht.
„Das ist mein Hauptfreund“, stellt sie Rolf Siegmeier vor. Er grinst. Ein bisschen stolz. Sieglinde Siegmeier schaut auf ihre Hände. „Aber es stimmt. Ich kann es wirklich nicht alleine“, sagt sie, begutachtet jeden Finger einzeln und sagt dann: „Ich bin die Frau der krummen Finger.“ Sie finde diesen Umstand zwar lästig, aber sie akzeptiert ihn. „Ich nehm‘ an, dass es Rheuma ist.“ „Es ist Osteoporose“, sagt Marina Siegmeier. „Nützt ja nix“, sagt Frau Sperling und zuckt mit den Achseln. Ob man es nun Rheuma nennt oder Osteoporose, an ihren krummen Fingern ändert das nichts.
"Ich bin die Frau der krummen Finger."
Die Geschichte der Familie Sperling/Siegmeier ist etwas außergewöhnlich.
Jede Woche bekommt Sieglinde Sperling Besuch von Marina und Rolf Siegmeier. Marina Siegmeier ist Sperlings Ex-Schwiegertochter – sie war mit Sperlings Sohn verheiratet. Mit Rolf Siegmeier ist Sieglinde Sperling weder verwandt noch verschwägert. Schließlich ist er der Ehemann ihrer ehemaligen Schwiegertochter. Ihn nennt sie ihren „Hauptfreund“.
Es ist ein sonniger Tag im Kieler September. Marina und Rolf Siegmeier besuchen heute wieder Sieglinde Sperling in ihrer Wohnung.
Zu Gast bei Frau Sperling fühlt man sich in eine Wohnung der 1970-er Jahre versetzt. Auf dem Tisch liegt eine creme-farbene Tischdecke, darauf eine Plastik-Orchidee in Purpur. Ein Café-Service aus blauem Porzellan mit Goldverzierung. Ein Aschenbecher aus der selben Serie, daneben Zigaretten, Feuerzeug, Kondensmilch.
Sperling wohnt in einer Ein-Zimmer-Wohnung. Von ihrem Sofatisch ist es ein kleiner Schritt bis zu ihrem Bett. Diesen einen kleinen Schritt kann Frau Sperling selbstständig aber nicht machen. Sieglinde Sperling ist 90 Jahre alt, sitzt im Rollstuhl und ist pflegebedürftig. Ihre Wohnung befindet sich in der Vaasastraße 2a. Diese Adresse teilt sie sich mit 242 weiteren Menschen. Sie ist Bewohnerin des „AWO-Servicehauses Mettenhof“.
Vergrößern

Foto: Ulf Dahl
Marina Siegmeier kümmert sich um alles, was „Siggi“ betrifft. Sie weiß, dass es sich ungewöhnlich anhört, dass sie sich um ihre ehemalige Schwiegermutter kümmert. Ungewöhnlich anfühlen tut es sich aber nicht. „Sie ist die Oma meines Sohnes. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich mich um sie kümmere“, sagt sie, „ich könnte sie gar nicht allein lassen.“ Sie weiß, welche Pfleger ihre Ex-Schwiegermutter besonders mag. Sie beendet die Sätze der 90-Jährigen, wenn ihr die Erinnerungen entfallen, sie den Faden verliert. Sie hat sich auch um die Wohnung im AWO-Haus und den Umzug gekümmert. „Ich hatte sie auf die Warteliste für eine Wohnung hier gesetzt, aber lange Zeit wollte sie nicht. ‚Nein, ich komme sehr wohl alleine zurecht‘, hat sie immer gesagt.“ So soll es sein, dachte Marina Siegmeier, wir verschieben so lange den Einzugstermin, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist.
Der Zeitpunkt kam. Im Jahr 2014 wurde klar, dass Sperling nicht mehr alleine in ihrem Haus zurecht kommen würde. Sie war zu schwach geworden. Körperlich und geistig. Sie konnte keine Treppen mehr laufen, es fiel ihr immer schwerer, sich selbstständig anzuziehen oder sich Essen zuzubereiten. Auf die Frage, wie es ihr nun gehe, antwortet Sperling: „Gut. Ich bin gesund. Ich bin nicht mehr so fit wie früher, aber ich bin stolz auf meine Falten.“ Während sie das sagt, grinst sie breit. „Ich kann auch nicht mehr so gut laufen, aber ein bisschen stehen – und am besten kann ich schnacken.“
Fühlt sie sich zuhause im AWO-Servicehaus? „Ja, doch“, antwortet sie, „aber ich bin ja kaum hier.“ Wo denn? „Na, die meiste Zeit bin ich im Treff.“ Der Treff ist die Tagespflege der Arbeiterwohlfahrt. Sieglinde Sperlings Tag beginnt damit, morgens geweckt zu werden. „Und dann muss ich aufstehen, und das will ich gar nicht“, sagt sie mit trotzigem Unterton. Sie wird gewaschen und zum Treff, der sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet, gefahren. Dort frühstückt sie, isst zu Mittag und zu Abend. „Da gibt es Kaffee und Kuchen, Bingo oder Singen, das geht schon in Ordnung“, sagt sie. Hat sie dort auch Freunde kennengelernt? „Sind alle nett da. Aber man muss ja auch nicht alles machen. Ich nehm‘ ja nicht jeden.“ Für ein wenig Schnack ist sie gern zu haben, aber man braucht sich ja nicht einbilden, schnell zu ihrem engeren Freundeskreis zu gehören.
Es ist schwierig, Sperlings „Hauptfreund“ zu werden, so wie der Mann ihrer Ex-Schwiegertochter es geschafft hat. Die beiden haben einen interessanten Umgang miteinander. Sie piesacken sich gegenseitig – das letzte Wort hat dabei aber meistens Frau Sperling.
Sperling weiß durchaus, dass sie mit Aussagen wie „Ich nehme ja nicht jeden“ Menschen zum Lachen bringt. Das scheint ihr auch eine gewisse Freude zu bereiten. Aber grundsätzlich meint sie das, was sie sagt, völlig ernst. Ja, die Leute im Treff seien nett, und ja, sie fühle sich hier in ihrer neuen Wohnung auch wohl, doch stets schwingt bei ihr der Nebensatz mit: „Aber man muss ja jetzt auch nicht übertreiben.“
Nicht gezwungenermaßen, sehr wohl aber wegen fehlender anderer Alternativen hält sie sich im Treff auf. Für sie ist das kein Grund so zu tun, als sei das die beste Zeit ihres Lebens. Zu dieser Etappe sagt sie bemerkenswert abgeklärt: „Es ist schon in Ordnung so. Nützt ja nichts.“ Aber auch: „Man muss auch wollen.“
Sperling weiß, dass die Zufriedenheit von der eigenen Einstellung abhängt. Sie ist gebürtige Rostockerin. Nach ihrer Heirat flohen ihr Mann Helmut – der Kieler war – und sie in die Bundesrepublik nach Kiel. „Wir sind mit nichts rübergekommen. Natürlich war das schwierig, es war Republikflucht.“ Helmut ist im Jahr 2000 gestorben. Viel dazu sagen möchte Sieglinde Sperling nicht. „Nützt ja nix“, sagt sie bloß. Und dass er ihre große Liebe war und sie ihn jeden Tag vermisst. Den Rest behält sie für sich.










Ein falsches Bild darf indes nicht entstehen. Natürlich ist Sieglinde Sperling ein wenig „tüddelig“. Ihr Langzeitgedächtnis leidet und dadurch gerät sie in Gesprächen oft ins Stocken. Sie vergisst Daten, Namen, Orte. Wann waren sie von Rostock nach Kiel geflohen? In welchem Jahr kam ihr Sohn auf die Welt? In welcher Straße hat sie gewohnt, bevor sie ins Servicehaus gezogen ist? Gleichzeitig ist sie absolut scharfsinnig. Ihr Verständnis für Ironie und ihr Zugang zu Sarkasmus sind erstaunlich. Es ist ein Leichtes für sie, ihr Gegenüber rhetorisch zu übertrumpfen.
Auf das AWO-Servicehaus kam Marina Siegmeier durch ihre Großmutter. Sie war die erste, die in das AWO-Haus einzog (im Frühjahr 1982) und bis 2000 dort wohnte. „Nach den guten Erfahrungen, die wir mit meiner Großmutter hier gemacht haben, dachte ich, dass das auch die richtige Entscheidung für Siggi ist.“ Siggi wohnt hier nun seit dem 3. April 2014. Im nächsten Monat zieht Siegmeiers Mutter in die Einrichtung ein. „Sie hatte vor kurzem eine Rücken-Operation und sagte nach ihrem Reha-Aufenthalt zu mir: ‚Wenn jetzt eine Wohnung frei wird, würde ich einziehen‘.“ Auch sie stand auf der Warteliste, auch sie bekam eine Wohnung. „In der zweiten Etage mit Balkon“, erzählt Marina Siegmeier. Sieglinde Sperling und Siegmeiers Mutter werden nun Nachbarn sein. Und das bindende Glied dieser Familienverstrickungen? Marina Siegmeier? „Rolf und ich haben uns auch schon auf die Warteliste für eine Zwei-Zimmer-Wohnung setzen lassen.“ Ernsthaft? „Ernsthaft.“ „Es gefällt uns hier. Deswegen wussten wir, lieber Vor- als Nachsicht.“
Ist das die moderne Form des Mehrgenerationen-Haushaltes? Eltern, Kinder und Großmütter leben nicht mehr zusammen in einem Haus, in denen die Pflege eine innerfamiliäre Angelegenheit ist, sondern kommen am Ende, jeder in seiner Wohnung, in einer Art Wohngemeinschaft karitativer Einrichtungen zusammen? Die Pflege kommt von Angestellten, das Wohnzimmer ist der AWO-Treff?
„Das ist schon eine außergewöhnliche Situation“, sagt André Springer. Er ist der stellvertretende Einrichtungsleiter im AWO-Servicehaus Mettenhof. „Mit dieser Konstellation bilden die Familien Siegmeier und Sperling schon eine Ausnahme. Im Regelfall leben hier ältere Menschen alleine in ihren Wohnungen, ohne Familienmitglieder in der Nachbarschaft. Die einen bekommen viel Besuch, die anderen wenig.“
Auch Sieglinde Sperling sieht ihre zukünftigen Nachmittage im Treff nicht gemeinsam mit ihrem Hauptfreund, Marina Siegmeier und deren Mutter.“Viel älter will ich nicht mehr werden.“ So wie sie das sagt, hat das nichts mit Lebensmüdigkeit zu tun, sondern mit Pragmatismus. So fatalistisch es klingen mag: Viel besser wird es ihr mit der Zeit wohl nicht mehr gehen. Dessen ist sie sich bewusst. Da gibt es nichts schön zu reden. Oder einfacher gesagt: „Nützt ja nix.“
Der Demographische Wandel
Wer sich beruflich mit dem Thema Alter und Pflege beschäftigt, spricht immer die selbe Warnung aus: Man muss sich mit dem eigenen Altern beschäftigen, solange man es noch kann. Was Marina und Rolf Siegmeier getan haben, ist ungewöhnlich aber nicht unvernünftig – im Gegenteil. Die Wartezeiten für solche Wohnungen in Einrichtungen wie die der Arbeiterwohlfahrt werden eher länger als kürzer. Den Grund dafür benennen kann erst mal jeder: Die deutsche Gesellschaft altert.
Dieser Kernsatz, der immer an vorderster Position steht, wenn es um den Demographischen Wandel geht, hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, die einander bedingen und beeinflussen. Maßgeblich ist vor allem das Verhältnis von Geburten- und Sterberaten. Erweitert man dieses Zusammenspiel um die Variable „Lebenserwartung“ landet man bei einem der medial und gesellschaftlich am häufigsten diskutierten Themen der Gegenwart. Hinter dem manchmal als staubtrocken verschrienen Thema „Demographischer Wandel“ stecken Zusammenhänge und Auswirkungen, die nicht nur viele, sondern so ziemlich alle Bürger auf ziemlich reelle Art und Weise betreffen.
Das liegt vor allem daran, dass der „Demographische Wandel“ so viele existenzielle Lebensbereiche tangiert, bestimmt, in die eine oder andere Richtung beeinflusst. Ein Blick darauf, welche Merkmale unter dem Begriff „Demographischer Wandel“ zusammengefasst werden, verdeutlicht, was für ein – um es mit Theodor Fontanes Worten zu sagen – weites Feld hier abgedeckt wird. Ganz allgemein geht es um die Bevölkerungsentwicklung. Etwas konkreter: Veränderungen der Altersstruktur der Bevölkerung, des quantitativen Verhältnisses von Männern und Frauen, der Anteile von Inländern, Ausländern und Eingebürgerten an der Bevölkerung, der Geburten- und Sterbefallentwicklung, der Zuzüge und Fortzüge. Noch konkreter wird es bei den Auswirkungen: auf das Rentenversicherungssystem, auf das Bildungssystem (gekennzeichnet durch die Zusammenschließung von Schulen), auf das Gesundheitswesen und insbesondere die Altenpflege – nur um einige zu nennen.
Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, wird man alt. Sprecherin des Statistischen Bundesamts
Mit diesen Auswirkungen sind Probleme und Herausforderungen verbunden – etwa wenn es um das Leben im Alter geht, denn es liegt in der Natur der Sache, dass das jeden Bürger betrifft. Wer nicht schon jetzt Eltern oder Großeltern hat, die Pflege in Anspruch nehmen (müssen), wird wahrscheinlich selbst im Alter auf Pflege angewiesen sein. Männer 78 Jahre und Frauen 83 Jahre: Das ist laut Statistischem Bundesamt die durchschnittliche Lebenserwartung von Mädchen und Jungen, die im Jahr 2016 auf die Welt kommen. Frauen, die bereits 65 Jahre alt sind, werden durchschnittlich 86 Jahre alt, 65-jährige Männer 82 Jahre alt.*
* Bei der Berechnung der Lebenserwartung werden die Sterbewahrscheinlichkeiten aller auf ein bestimmtes Alter folgenden Altersstufen einbezogen. Personen, die beispielsweise 65 Jahre alt sind, haben die Sterberisiken vorangegangener Altersstufen (Alter von 0 bis 64) bereits hinter sich gelassen und sind nur noch den Risiken ihres eigenen und des höheren Alters ausgesetzt. Sie weisen deshalb höhere Werte für die (Gesamt-)Lebenserwartung auf als Neugeborene. Kinderkrankheiten, Unfälle, jugendliches Risiko-Verhalten wird bei der Lebenserwartung eines 65-Jährigen nicht miteinberechnet, entsprechend haben sie eine höhere Lebenserwartung. Eine Sprecherin des Statistischen Bundesamts fasste diese statistische Annahme charmant zusammen: „Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, wird man alt.“
Das bedeutet: Alt werden und in der Konsequenz auf Hilfe angewiesen sein, betrifft sehr viele Menschen. Doch wie werden wir alt? Die Antwort lautet: Oft allein. Das betrifft insbesondere Frauen. Sie haben einen sehr viel höheren Anteil an den über 80-Jährigen, da ihre Ehemänner oft früher sterben. Hinzu kommt: In kaum einer Familie leben Senioren mit ihren Kindern und Enkelkindern zusammen. Der Anteil der Dreigenerationen-Haushalte ist verschwindend gering. Die Zahl der Haushalte mit drei oder mehr Generationen ist zwischen 1995 und 2015 von 351.000 auf 209.000 zurückgegangen. Das entspricht einem Rückgang von 40,5 Prozent.
Einen ähnlichen Trend zeigen die Zwei Generationen-Haushalte auf: 2015 lebte in 266.000 Haushalten die mittlere Generation mit den Eltern zusammen – vor 20 Jahren waren es noch 324.000 Haushalte. In Relation zu allen Haushalten in Deutschland wird es besonders klar: Nur in 0,5 Prozent aller Haushalte in Deutschland leben und wirtschaften drei oder mehr Generationen. Zwei-Generationen-Haushalte aus mittlerer und älterer Generation bilden 0,7 Prozent aller Haushalte (in denen lebt zu 62,8 Prozent nur ein Elternteil). Das bedeutet, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir von unseren Kindern – so wir denn welche haben – im traditionellen Sinn gepflegt werden. Wir werden uns Pflege und ja, auch Gesellschaft, als Dienstleistung erkaufen müssen. Im Dezember 2013 waren 82.692 Menschen in Schleswig-Holstein pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes. In ganz Deutschland waren es 2,63 Millionen Menschen; die Mehrheit (65 Prozent) waren Frauen. 69 Prozent der Pflegebedürftigen waren 75 Jahre und älter; 85 Jahre und älter waren 37 Prozent. Interessant ist auch die Frage nach der Pflegequote: Von allen 85- bis 89-Jährigen werden wieviele gepflegt? Hier variieren die Anteile zwischen den Bundesländern sehr stark. Im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern ist die Pflegequote am höchsten: Dort beträgt der Anteil der Pflegebedürftigen bei den 85- bis 89-Jährigen 51 Prozent. Die niedrigsten Anteile gibt es in diesem Alter hingegen in Bayern und im Land zwischen den Meeren: In Schleswig-Holstein sind 33 Prozent aller 85- bis 89-Jährigen pflegebedürftig.
Zur Einordnung: Von den insgesamt 2,63 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland war 2013 mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Pflegestufe I zugeordnet. Ein knappes Drittel (32 Prozent) erhielt Leistungen der Pflegestufe II. Der Anteil der Schwerstpflegebedürftigen (Pflegestufe III) betrug rund 12 Prozent. Bei weiteren 109.000 Personen lag keine Pflegebedürftigkeit bzw. Pflegestufe nach den Definitionen des Pflegeversicherungsgesetzes vor, aber es war bei ihnen eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz festgestellt worden. Zur Art der Pflege: Mehr als zwei Drittel (71 Prozent bzw. 1,86 Millionen) der Pflegebedürftigen wurden zu Hause versorgt. Davon erhielten 1.246.000 Pflegebedürftige ausschließlich Pflegegeld, das bedeutet, sie wurden in der Regel zu Hause allein durch Angehörige gepflegt. Weitere 616.000 Pflegebedürftige lebten ebenfalls in Privathaushalten. Bei ihnen erfolgte die Pflege jedoch zusammen mit oder vollständig durch ambulante Pflegedienste. 29 Prozent (764 000) wurden in Pflegeheimen vollstationär betreut.
Auch bei der Frage nach der Art der Pflege hat Schleswig-Holstein ein besondere Stellung: Im bundesweiten Vergleich hat die Pflege in Heimen hier die größte Bedeutung – 40 Prozent aller Pflegebedürftigen wurden 2013 in Schleswig-Holstein vollstationär versorgt. Zum Vergleich: In Brandenburg wurden nur 23 Prozent der Pflegebedürftigen in Heimen vollstationär betreut. Insgesamt hat sich die Zahl der Pflegebedürftigen in Schleswig-Holstein von 2011 bis 2013 um 3,1 Prozent erhöht – deutschlandweit liegt die Erhöhung bei 5 Prozent.
So sehen die Zahlen aus. Was aber bedeuten diese Zahlen? Unter anderem, dass die Pflege als Branche florieren wird. Besonders gut sieht man das etwa an dem Kieler Pflegedienst: „Teamwerk Pflege und Assistenz“.
Vergrößern

Foto: hfr
2014 hatte der mobile Pflegedienst „Teamwerk“ genau einen Patienten. 2015 bereits drei Intensiv-Patienten. Seit dem melden sich wöchentlich neue Patienten beim Pflegedienst. Seit acht Wochen ist „Teamwerk“ eine GmbH und hat 50 Angestellte, von denen zwei Drittel Vollzeit beschäftigt sind. Zu ihren Leistungen gehört die außerklinische Intensivpflege von beatmungspflichten Patienten und Menschen mit anderen intensivmedizinischen Indikationen und die ambulante Kranken- und Altenpflege. „Wenn man erlebt, wie brutal eine Krankheit einschlagen kann, dann wird man bescheiden“, sagt Bettina Krohn, Inhaberin und Geschäftsführerin von Teamwerk. Es gehe nicht nur um die Krankheit des Patienten – ob nun Querschnittslähmung oder Demenz – es gehe auch um das ganze Drumherum. Oft seien es die Angehörigen, um die man sich besonders stark mitkümmern müsse. „Die Angehörigen müssen nicht nur mit einem Schicksalsschlag zurechtkommen, sondern auch mit seinem Management.“
Den Faktor Mensch darf man nicht unterschätzen. Bettina Krohn
Es fehle oft an Hilfestellung in der Pflege, sagt die 50-Jährige. „Angehörige werden in einen Teich geworfen und müssen plötzlich mitschwimmen, ohne sich auszukennen, ohne zu wissen wohin überhaupt.“ Das führe zu einer besonderen Gemengelage: Der Patient, die Krankheit, der Angehörige und nicht zu vergessen: der Pfleger. „Das ist ein harter Job. Unsere Angestellten dringen in die Privatsphäre der Menschen ein. Sie müssen weitestgehend unsichtbar sein. Sie müssen zu dem Patienten passen, aber auch zu dem Sohn, der Tochter oder der Ehefrau – es ist also von allen Seiten kompliziert.“
Von allen Seiten kompliziert, weil es immer Menschen sind, die aufeinandertreffen. Mit eigenen Geschichten, eigenen Herangehensweisen, eigenen Befindlichkeiten. „Wenn ich in dieser kurzen Zeit eines gelernt habe, dann ist es das: Den Faktor Mensch darf man nicht unterschätzen.“
Das sensible Konstrukt aus Patient, Angehörigen und Pfleger verkompliziert sich, wenn einer der Beteiligten sich nicht wohl fühlt, zum Beispiel der Pfleger. „Oft kommen Pflegekräfte mit dem Zeitdruck, der in vielen stationären Einrichtungen herrscht, nicht zurecht. Sie wünschen sich mehr Zeit für die persönliche Ansprache, doch stattdessen müssen sie von Zimmer zu Zimmer eilen, damit alle Patienten versorgt sind“, so Krohn. Das liege weniger an den Einrichtungen, als vielmehr am Pflegenotstand in Deutschland. „Viele Pflegekräfte sind ausgebrannt, auch weil oft die Wertschätzung auf der Strecke bleibt.“ Krohn selbst ist Quereinsteigerin und kommt aus dem medizin-journalistischen Bereich. Bei Teamwerk sei die Hierarchie flach und die Arbeitszeiten seien ganz andere. „Unsere Intensivpatienten werden in der Regel im Zwei-Schicht-System 24 Stunden betreut. Zwölf Stunden sind eine lange Zeit, aber so kann sich die Pflegekraft wirklich auf den Patienten einlassen und hat genügend Zeit für die individuelle Versorgung.
Nach 30 Jahren Pflege in Krankenhäusern und Seniorenheimen hat auch Ilona Afshar ihre Ruhe gefunden. Bei Florentina Hansen*.
Die mobile Pflege
Ilona Afshar ist bei Teamwerk angestellt. Sie kümmert sich an vier Tagen in der Woche jeweils sechs Stunden um die 87-jährige Florentina Hansen
Krankenschwester Ilona Afshar ist glücklich über ihren neuen Arbeitsalltag. „Im Krankenhaus ist es eine körperlich sehr anstrengende Arbeit, die man verrichten muss. Das war dann irgendwann mit meiner eigenen Gesundheit nicht mehr zu vereinbaren“, erzählt die 55-Jährige. Ihre Gesundheit, aber auch ihr Selbstverständnis als Krankenschwester haben sie zu einem Wechsel des Arbeitgebers gebracht. „Krankenschwester war immer mein Traumberuf. Es ist toll, dass man Menschen helfen kann. Dass man daran arbeitet, dass Menschen wieder gesund werden und nach Hause gehen können.“ Aber mittlerweile seien die Umstände schlimm geworden: „Es ist nur noch eine Abfertigung der Patienten.“
Für Florentina Hansen hat Ilona Afshar jetzt genug Zeit. „Es ist vor allem eine psycho-soziale Betreuung“, beschreibt Afshat ihre Arbeit. Sie essen gemeinsam, tauschen sich aus, Florentina Hansen bekommt Struktur in ihren Alltag. „Oft ist es ja so, dass ältere Menschen einfach nur Gesellschaft, jemanden zum reden brauchen“, so Afshar. „Ich weiß, dass das eine Luxussituation ist – für sie und für mich.“
Es ist vor allem eine finanzielle Frage, ob eine Pflege, so wie sie Hansen in Anspruch nimmt, gewährleistet werden kann. Florentina Hansen ist der Pflegestufe I zugeordnet. Ein Gros dessen, was sie täglich an Zeit und Kompetenz bekommt, bestreitet sie aus eigenen Mitteln. „Sicher würde sie sich freuen, wenn sie ihre Familie öfter sehen könnte“, sagt Afshar. Hansen hat eine Tochter, einen Sohn, drei Enkel und zwei Urenkel.
Und nun?
Im Dezember 2013 hatte Schleswig-Holstein 2.815.955 Einwohner, davon waren 148.443 Menschen 80 Jahre und älter. Für das Jahr 2035 berechnet das Statistikamt Nord für Schleswig-Holstein in dieser Altersgruppe 254.200 Menschen, bei einer Gesamtpopulation von 2.706.000 Menschen.
Die animierte Bevölkerungspyramide zeigt an, in welchem Jahr wie viele Frauen und Männer wie alt sein werden. Ausgegangen wird von einer konstanten Geburtenhäufigkeit von 1,4 Kindern je Frau, von einer Lebenserwartung von 84,8 beziehungsweise 88,8 Jahren bei Geburt 2060 und einem Wanderungssaldo von jährlich + 100.000 Menschen ab 2021. Auf der Internetseite des Statistischen Bundesamts können unterschiedliche Bevölkerungspyramiden unter verschiedenen Annahmen betrachtet werden.
Die Vorausberechnungen der statistischen Ämter machen deutlich: Der Anteil der Sieglinde Sperlings und Florentina Hansens in Deutschland wird größer werden. Einen zu frühen Zeitpunkt, um sich mit dem eigenen Altern und Pflegebedürftigkeit auseinanderzusetzen, gibt wohl es nicht. Bürgertelefone und Pflegestützpunkte können eine erste Orientierung sein. Auf der Internetseite des Landes Schleswig-Holstein zum Beispiel sind Ansprechpartner, Organisationen und Telefonnummern aufgelistet.
Der Demographische Wandel ist nicht nur für jeden einzelnen eine Herausforderung, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche. Es ist abzusehen, dass neue, innovative Geschäftsmodelle, die den Senioren, Patienten und Pflegern gleichermaßen entgegenkommen, boomen werden. Wie flexibel sich der Gesetzgeber dazu verhalten wird, bleibt abzuwarten. Aus diesen Herausforderungen bieten sich gerade für junge Menschen auch Chancen: Kein anderer Zeitpunkt als jetzt eignet sich besser, um in die Pflegebranche einzusteigen – ob als Mediziner, Pfleger, Unternehmer, Wissenschaftler oder Therapeut.
Was aber ist mit dem wohl schwierigsten Thema? Der eigenen Vergänglichkeit? Ein wenig Lebenslust, ein wenig Pragmatismus und ein kleines bisschen Demut dürften den Umgang mit dem eigenen Altern erleichtern. Denn wie Sieglinde Sperling schon sagt, es nützt ja wirklich nichts.
Fotos: Ulf Dahl (Zu Gast bei Sieglinde Sperling) und Sonja Paar (Florentina Hansen und Ilona Afshar)








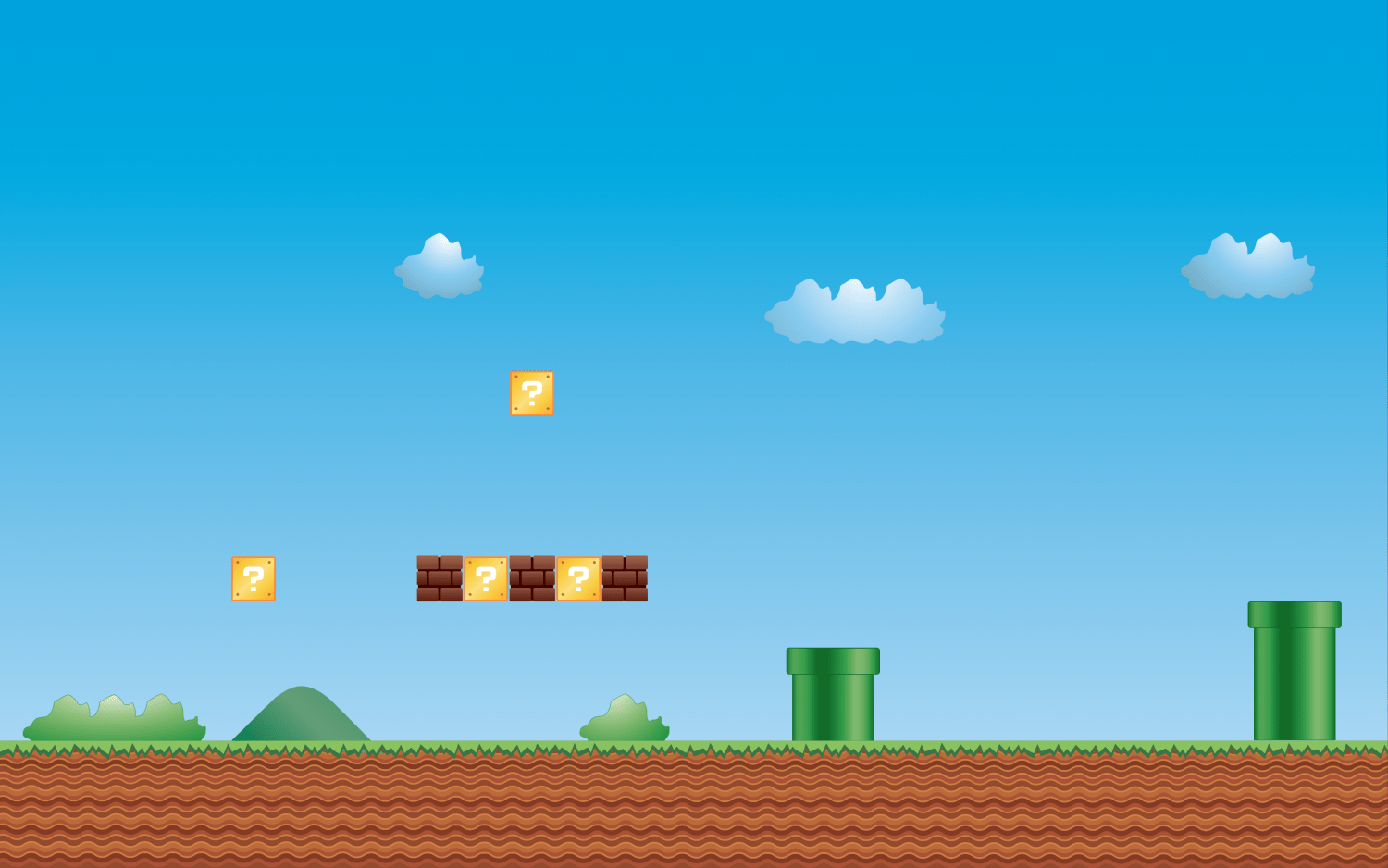
Danke für den umfassenden Beitrag, …
_______ der durch sachliche Information über „reine Daten“
_______ bis hin zum individuellen Einblick in das Leben…
___ von einzelnen älteren Menschen,
___ der Betreuenden (vor Ort)
___ und auch der Familien…
eine Bandbreite von Möglichkeiten zum Mitspüren und Miterleben anbietet.
Sehr gern teile ich das Link.